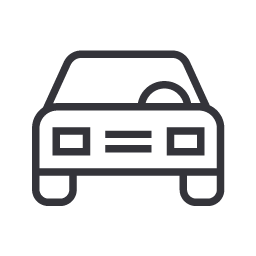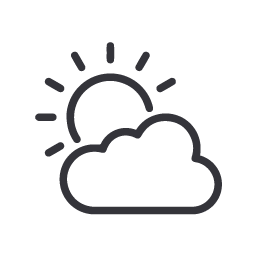Oscars: Darum dreht sich der beste Film
Menschen, die „Everything Everywhere All at Once“ gesehen haben, wissen: Es ist schwer zu erklären, worum es in diesem Werk geht, das bei den Oscars als bester Film ausgezeichnet wurde. Der Grund: Der Film bombardiert seine Zuschauer mit unzähligen Plot Twists, Einfällen und visuellen Referenzen. Alleine ein Genre zu definieren, in das „Everything Everywhere All at Once“ passt, ist fast unmöglich – denn der Film kombiniert in einem anarchischen Mix Elemente aus Science-Fiction, Fantasy, Martial Arts, Slapstick-Komödie und Familien-Drama.
„Everything Everywhere All at Once“ erzählt von der chinesischen Immigrantin Evelyn (gespielt von Michelle Yeoh, einer malaysischen Schauspielerin chinesischer Abstammung), die in den USA einen Waschsalon betreibt und von ihrem Alltag gestresst ist. Nach einem Fehler in ihrer Steuererklärung wird ihr Waschsalon von der Steuerbehörde geprüft. Dazu kommen familiäre Probleme: Ihr Mann Waymond (Ke Huy Quan) konfrontiert sie mit Scheidungspapieren, ihre Tochter Joy (Stephanie Hsu) ist mit einer Frau zusammen, was Evelyn vor ihrem vermeintlich strengen Vater verbergen will, der gerade aus China angereist ist.
Während eines Besuchs in der Steuerbehörde, wo die garstige Steuerfahnderin Deirdre (Jamie Lee Curtis) ihre Unterlagen prüfen will, verwandelt sich ihr Ehemann plötzlich in eine alternative Version seiner selbst aus einem anderen Universum. „Alpha Waymond“ erklärt Evelyn, dass mehrere Paralleluniversen mit unterschiedlichen Versionen ihrer selbst existieren. Die Gesamtheit aller Paralleluniversen – das sogenannte Multiversum – sei von einer bösen Macht bedroht und nur Evelyn könne diese aufhalten.
Die Finanzbehörde verwandelt sich nun in einen wilden Martial-Arts-Kampfplatz. Evelyn reist durch unterschiedliche Universen und versucht, auf die Fähigkeiten all der Versionen ihrer selbst zuzugreifen, um gegen das Böse zu kämpfen. Dabei merkt sie, dass ihre Alternativ-Versionen deutlich spannendere Leben führen als sie – und kommt ins Grübeln, ob sie in ihrem Leben wohl oft falsch abgebogen ist.
Die Zuschauer finden sich in Welten wieder, in der Menschen Hotdogs als Finger haben oder keine Menschen mehr sind, sondern Steine. Zu solch absurden Gags kommt noch hinzu, dass die Regisseure Daniel Kwan und Daniel Scheinert Referenzen auf alle möglichen Filme der Vergangenheit einbauen. Man verliert schonmal den Faden in diesem Chaos. Sicher ist jedenfalls: So etwas hat man im Kino noch nie gesehen.
Es ist eine willkommene Abwechslung, dass die Idee der parallelen Universen einmal nicht in einem Marvel-Film zu sehen ist, sondern hier auf eine ganz andere, die migrantische Erfahrung übertragen wird. Was Evelyn und Waymond erlebt haben, war eine Welt mit wenigen Optionen – für ihr Kind gilt das nicht mehr.
Bei allen Schrulligkeiten hat der Film auch einen soziologischen und emotionalen Kern. Da ist zum einen eine anrührende Familiengeschichte. Und eine Idee, die auch viel über unsere Gegenwart erzählt. So leben wir in einer Welt, in der uns andere Möglichkeiten und Entscheidungen immer wieder vor Augen geführt werden. Wo wir uns ständig entscheiden müssen, was auch mal überfordernd sein kann. Die Frage, ob wir das für uns selbst beste Leben führen, wurde wohl selten witziger durchgespielt als in diesem Film.
(text:sda/bild:sda)