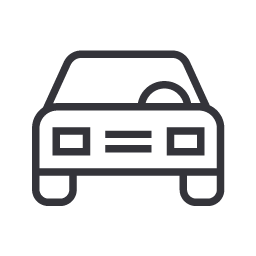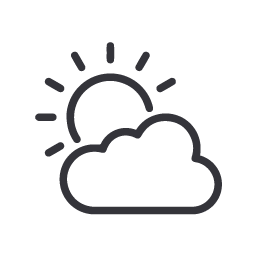In der Pandemie leiden mehr Jugendliche an Suizidgedanken
Verzeichnete das Krisen-, Abklärungs-, Notfall- und Triagezentrum (KANT) der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich im ersten Halbjahr 2019 noch 321 Notfalluntersuchungen, waren es zwischen Januar und Juni 2021 bereits 450. Dies teilte Gregor Berger, leitender Arzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit
Berger bestätigte damit einen Bericht der „Sonntagszeitung“. Während bei den Notfalluntersuchungen ein Anstieg um 40 Prozent verzeichnet wurde, verdoppelte sich die Zahl der telefonischen Notfallkontakte gemäss einer Studie eines Teams um Berger beinahe – von 880 auf 1744.
Der Anteil der Jugendlichen, die von Suizidgedanken berichteten, nahm im untersuchten Zeitraum von 69 auf 86 Prozent zu. Zugleich stieg der Anteil der Patientinnen und Patienten, die von Selbstverletzungen berichteten, von 31 auf 48 Prozent. Zum selbstverletzenden Verhalten werden namentlich Suizidversuche gezählt.
Gemäss der Studie nahm im Kanton Zürich insbesondere seit den Sommerferien 2020 auch die Zahl der Minderjährigen zu, die in die Erwachsenenpsychiatrie aufgenommen wurden – und bleibt seither hoch. Zu dieser Massnahme wird laut den Studienautorinnen und -autoren nur gegriffen, wenn eine Hospitalisation unumgänglich ist und in spezialisierten Einrichtungen kein Platz mehr zur Verfügung steht.
Zürich steht mit der Entwicklung nicht allein da: Die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern habe im Jahr 2021 über 50 Prozent mehr suizidale Minderjährige auf der Notfallstation betreut als im Vorjahr, berichtete am Sonntag die „Sonntagszeitung“.
Man beobachte bereits seit zehn Jahren, dass das Zürcher Notfallzentrum der Kinder- und Jugendpsychiatrie stärker in Anspruch genommen werde, so Berger weiter. Durch die Pandemie habe sich der Trend allerdings deutlich akzentuiert.
Aus seiner Sicht sei seit der Jahrtausendwende der Druck auf die Jugendlichen gestiegen, erklärte Berger. Zum Teil würden schon am Ende der Primarstufe erste Weichen gestellt. Viele Eltern fühlten sich unter Druck, ihre Kinder anzutreiben, damit sie es ins Langzeitgymnasium schafften.
Eine ähnliche Entwicklung sieht Berger im Sport: Dort müssten Kinder in immer mehr Sportarten schon im Primarschulalter Leitungen erbringen oder eine bestimmte Anzahl Trainingseinheiten absolvieren, um mitmachen zu dürfen. Früher sei dies nur in wenigen Disziplinen der Fall gewesen.
Als problematisch beurteilt Berger auch die Entwicklung beim Medienkonsum: Gemäss Untersuchungen seiner Klinik ist der durchschnittliche tägliche Handykonsum in der Freizeit in der ersten Corona-Welle von vier auf sechseinhalb Stunden gestiegen – und mit der Lockerung der Massnahmen nicht mehr gesunken.
Durch die immer längere Zeit am Handy habe sich der Lebensstil der Teenager verändert, so Berger. Die Schlafdauer sei deutlich kürzer. Jugendliche auf der Notfallstation hätten häufig einen Medienkonsum von acht Stunden oder mehr am Tag. Zumindest bei den Patientinnen und Patienten beobachte man einen Rückgang bei der körperlichen Aktivität und den Interaktionen mit der realen Welt.
In der Pandemie haben es laut dem Kinder- und Jugendpsychiater insbesondere Jugendliche schwer, die vorher schon Mühe hatten, den an sie gestellten Ansprüchen zu genügen. Wenn bei der Berufswahl keine Schnupperpraktika möglich seien, erschwere dies den Einstieg in eine normale Entwicklung.
Als Risikofaktor sieht Berger auch den frühen Konsum von Drogen, insbesondere von Cannabis. In Zürich liege der THC-Gehalt von konfisziertem Gras oder Haschisch häufig über 20 Prozent, während Ende der 1960er-Jahre, zu Zeiten von Woodstock, ein THC-Gehalt von drei bis fünf Prozent üblich gewesen sei. Studien zeigten zunehmend, dass bei Personen, die in einem jungen Alter Cannabis konsumiert hätten, sowohl die Suizidrate als auch der Anteil von schweren psychischen Krankheiten Betroffener gegenüber der Gesamtbevölkerung erhöht sei.
In allen Bildungsschichten werde zudem durch die zunehmende Mobilität die Einbettung in die Grossfamilie schwächer, hob Berger hervor. Damit falle ein positiver, stabilisierender Faktor weg.
Der Experte schätzt, dass 10 bis 20 Prozent der Jugendlichen psychisch besonders verwundbar sind. Bei ihnen führten die genannten Belastungen zu einem Anstieg psychischer Probleme. Suizidalität sei dabei nur die Spitze des Eisbergs.
(text:sda/bild:unsplash)