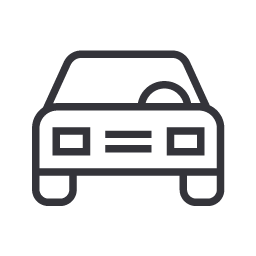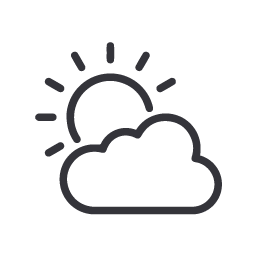25 Jahre Karfreitagsabkommen: Ein Konstrukt mit Rissen?
Die Schüsse trafen ihn, als er gerade Fussbälle nach einem Training in den Kofferraum seines Autos laden wollte. Der nordirische Polizist John Caldwell wurde im Februar in dem Ort Omagh von mehreren Maskierten vor den Augen seines Sohns und anderer Jugendlicher angegriffen und schwer verletzt.
25 Jahre nach dem Friedensschluss im Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998 ist die ehemalige Bürgerkriegsregion Nordirland noch immer nicht vollständig zur Ruhe gekommen. Die Ermittler vermuten eine Splittergruppe der früheren Untergrundorganisation IRA (Irish Republican Army) hinter dem Anschlag. Erst kürzlich erhöhte der britische Inlandsgeheimdienst MI5 die Terrorwarnstufe für die Provinz.
Das Karfreitagsabkommen beendete einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen meist katholischen Befürwortern einer Vereinigung der beiden Teile Irlands auf der einen Seite sowie überwiegend protestantischen Anhängern der Union mit dem Vereinigten Königriech, Polizei und britischer Armee auf der anderen Seite. Etwa 3700 Menschen kamen in dem Konflikt ums Leben. Ungefähr 47 500 wurden verletzt.
Damit sind die sporadischen Gewaltausbrüche von heute – trotz des brutalen Anschlags auf Caldwell – nicht zu vergleichen. Doch das Abkommen ist in einem „sorry state of disrepair“ (einem bedauernswert baufälligen Zustand), wie es die Politsoziologin Katy Hayward von der Queen’s Universität in Belfast ausdrückt. Zu den Vereinbarungen gehört eine Klausel zum „Powersharing“ (Machtteilung). Demnach muss die Regionalregierung gemeinsam von den beiden jeweils grössten Parteien beider Lager gestellt werden.
Doch da sich oft eine der beiden Parteien verweigert, ist die Region immer wieder politisch gelähmt – auch jetzt wieder. Nicht einmal das Parlament kann ohne eine Einigung zusammentreten. „Es gab in vier der vergangenen sechs Jahre keine funktionierende Regionalversammlung“, schreibt Hayward in einem Beitrag für die Denkfabrik Chatham House. Ihr Fazit: Das Abkommen muss dringend saniert werden.
Immerhin konnte der jahrelange Streit zwischen Brüssel und London um die Brexit-Regeln für die Provinz gerade rechtzeitig zum Jubiläum mit dem sogenannten Windsor-Rahmen beigelegt werden. Das galt als Voraussetzung für einen Besuch des US-Präsidenten Joe Biden, der nicht nur stolz auf seine irische Herkunft ist, sondern auch mit grosser Besorgnis auf die Herausforderungen blickte, die der Brexit für das Friedensabkommen mit sich gebracht hatte.
Der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs sei die grösste unmittelbare Herausforderung für den Friedensprozess gewesen, sagt Tony Blair in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und den europäischen Nachrichtenagenturen AFP, EFE und ANSA kurz vor dem Jahrestag. Der frühere britische Premierminister war einer der Hauptarchitekten des Karfreitagsabkommens.
Das Problem liegt vor allem daran, dass mit dem Brexit die eigentlich bereits unsichtbar gewordene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland zur EU-Aussengrenze geworden ist. Kontrollposten zwischen Nordirland und Irland, da waren sich aber alle Seiten einig, wären zum Ziel neuer Anschläge geworden. Diese Aussicht habe „alles aufs Spiel gesetzt“, sagt Blair. Nun gebe es Hoffnung, dass die Probleme überwunden werden können.
Blair betrachtet das Karfreitagsabkommen inzwischen als sein grösstes Vermächtnis, aber auch er spricht sich für Anpassungen aus. Man müsse das Abkommen „verändern, wenn sich Dinge ändern“, sagt er. So sei die wachsende Bedeutung der überkonfessionellen Partei Alliance ein wichtiger Faktor. Das zeige, dass es eine Gruppe von Menschen gebe, die „nicht an den alten Debatten über Katholiken, Protestanten, Unionisten und (irische) Nationalisten interessiert sind“.
Die Alliance Party wurde bei der Regionalwahl im vergangenen Jahr drittstärkste Kraft. Parteichefin Naomi Long zeigt sich zunehmend frustriert, dass sie nach den geltenden Regeln keine Chance auf eine Regierungsbeteiligung hat. Sie bezeichnet die derzeit von der protestantisch-unionistischen Partei DUP aufrechterhaltene Blockade der sogenannten Stormont-Institutionen als „politische Geiselnahme“, die aufhören müsse. Ihre Partei will nun prüfen, ob sie rechtliche Schritte gegen die derzeitige Regelung unternehmen kann.
Die DUP sieht ihre Blockade als Protest gegen die Brexit-Regeln für Nordirland. Die Partei hatte den EU-Austritt eigentlich befürwortet. Gemeinsam mit den Brexit-Hardlinern in der konservativen britischen Regierungspartei sorgte sie sogar dafür, dass es ein harter Brexit mit Austritt aus dem Europäischen Binnenmarkt und der Zollunion wurde. Doch was dabei herauskam, ist gar nicht in ihrem Sinne.
Ex-Premier Boris Johnson, der die DUP mit leeren Versprechungen abspeiste, vereinbarte mit Brüssel einen Sonderstatus für Nordirland, der die notwendig gewordenen Kontrollen in die Irische See verlegte. Die Provinz war damit weiter von Grossbritannien (England, Schottland, Wales) weggerückt, nicht näher hin, wie es sich die DUP vom Brexit wohl erhofft hatte. Auch eine irische Einheit sei dadurch wieder stärker in den Fokus gerückt, glaubt Blair. „Die Wahrheit ist, dass nichts die Vereinigung so sehr wieder auf die Tagesordnung gebracht hat wie der Brexit“, so der frühere Regierungschef.
Das Dilemma, in dem die protestantischen Befürworter der Union stecken, ist, dass die Zeit gegen sie arbeitet. Im einst als protestantische Mehrheitsgesellschaft gegründeten Nordirland leben inzwischen mehr Katholiken als Protestanten. Bei der Wahl im vergangenen Jahr wurde die einst als politischer Arm der IRA geltende katholisch-republikanische Partei Sinn Fein erstmals stärkste Kraft.
Ob die DUP mit ihrer Blockadehaltung diese Entwicklung aufhalten kann, gilt als fraglich. Sollte sie nicht bald in eine Regierungsbildung einwilligen, wäre eine vorgezogene Wahl unausweichlich. Gut möglich, dass sie dabei noch weiter an Rückhalt verliert. Anders als die DUP habe es Sinn Fein verstanden, ihre Strategie zu ändern, sagt Blair. „Wenn du dich nicht anpasst, bist du in Schwierigkeiten“, so der frühere Labour-Chef.
(text:sda/bild:unsplash)